Ein überzeugender Vortrag ist eine großartige Möglichkeit, sichtbar zu werden, die eigene Expertise zu zeigen und dem Publikum eine neue Perspektive zu vermitteln. Dabei steht die Sicherheit der vortragenden Person in direktem Verhältnis zur Wirksamkeit. Je besser vorbereitet ein Vortrag ist, desto mehr Resonanz kann er entfalten. Das liegt zu einem großen Teil an dem, was in der klassischen Rhetorik „Ethos“ genannt wird. Ethos beschreibt die Glaubwürdigkeit einer Person. Ein Redner (oder eine Rednerin), der unsicher wirkt, sich in seiner Argumentation verheddert und am Ende des Vortrags nach einem hingenuschelten „danke“ so schnell wie möglich von der Bühne huscht, vermittelt weniger Glaubwürdigkeit, als eine Rednerin (oder ein Redner), die sich in ihrem Vortrag zuhause fühlt, genau weiß, in welcher Reihenfolge sie etwas mitteilen wird, zu welchem Zweck, vor welchem Publikum und die gelassen am Ende des Vortrags vor ihrem Publikum steht, sich bedankt und für Applaus oder Fragen oder eine Diskussion zur Verfügung steht. In diesem Blogartikel erkläre ich dir, wie du in 9 Schritten einen überzeugenden Vortrag vorbereitest.
1. Ziel klären – Was willst du erreichen?
Das Ziel deines Vortrags ist das A und O. Das Ziel definiert, was du sagst und was du weglässt, wie du dein Publikum adressierst und wie du dich selbst zeigst. Das Ziel bestimmt deine Tonalität, die mit dem ersten Satz vorhanden ist. In meinen Coachings versuchen viele Teilnehmer*innen, das Ziel beim Reden zu finden. Das ist ein guter Zwischenschritt und für Menschen, die redend besser denken können als schreibend, ist das ein gutes Mittel auf dem Weg zum überzeugenden Vortrag. Aber: Es ist ein Zwischenschritt. Stell dir die Zielsetzung wie das Ziel einer Reise vor. Bevor du losfährst, entscheidest du dich, ob du nach Rom, Bielefeld oder Südamerika möchtest. Du setzt dich nicht einfach aufs Fahrrad, und schaust, ob du glücklicherweise da landest, wo du hinwolltest. Du planst, du buchst und dann fährst du mit dem passenden Verkehrsmittel los. Bei einem überzeugenden Vortrag weißt du, wo du hinwillst und planst entsprechend. Du entscheidest dich für ein Ziel und planst deine Schritte in genau diese Richtung.
So findest du dein Ziel: Worum geht´s?
Stelle dir folgende Fragen: Geht es dir um reine Informationsweitergabe („Die Feuerlöscher hängen im Treppenhaus“)? Möchtest du motivieren („Engagiert euch ehrenamtlich – es ist unbezahlbar“)? Willst du Menschen inspirieren („Jeder Mensch kann präsentieren!“)? Willst du eine Entscheidung voranbringen und dein Publikum überzeugen („Nachhaltigkeit stärkt die Glaubwürdigkeit unseres Unternehmens“)? Oder möchtest du eine Lobrede halten, zum Firmenjubiläum oder anlässlich eines runden Geburtstages („Frau XY hatte den Mut, ihrer Vision zu folgen…“ oder „Du bist der beste Opa der Welt“)?
Oder anders gefragt: Wie sollen sich die Zuhörer*innen nach deinem Vortrag fühlen? Informiert? Motiviert? Inspiriert? Entscheidungsfreudig? Überzeugt? Begeistert? Gerührt?
Welches Ziel liegt deinem Vortrag zugrunde?
Was ist eine Kernbotschaft?
Die Kernbotschaft ist die eine Botschaft, die dein Publikum mitnimmt. Die es unbedingt verstanden haben und erinnern sollte nach deinem Vortrag. Hilfreich ist die Frage: Wenn das Publikum nur einen Aspekt deines Vortrags erinnert – welcher sollte das sein? Ich rede z. B. häufig über das Thema Vorträge halten. Da gibt es viele interessante und wichtige Aspekte und eine Menge mögliche Botschaften. Das Ziel, das ich mit meinen Vorträgen verfolge, ist Motivation und Empowerment. Meine Kernbotschaft kann z. B. sein: „Der Umgang mit Nervosität lässt sich trainieren!“
Was ist deine Kernbotschaft? Was soll dein Publikum auf jeden Fall mitnehmen?
Finde deine Kernbotschaft!
Sich darüber klar zu werden, was wir mit einer Keynote, einem Vortrag, einem Referat erreichen wollen, erfordert Mühe. Auf den ersten Blick erscheint es einfacher, drauflos zu reden. Auf den zweiten Blick wird deutlich: Wenn wir uns mit der Kernbotschaft befassen, werden die folgenden Schritte viel klarer, weil sie sich auf die Kernbotschaft beziehen. Ich arbeite zum Finden der Kernbotschaft gerne mit Listen. Schreibe 10 mögliche Kernbotschaften auf. Schau dir die Liste an. Welche Botschaften treffen den Kern deines Anliegens? Welche keinesfalls? Wenn nötig, wiederhole die Übung. Versuche, immer genauer auf den Punkt zu kommen.
Eine andere Methode ist, den Vortrag mit nur einem Satz zu beschreiben. Stell dir vor, die Direktorin von XY steht unverhofft vor dir und fragt interessiert: „Was ist das eigentlich für ein Vortrag, den Sie da anbieten?“ Was antwortest du kurz und bündig?
2. Das Publikum analysieren – Für wen sprichst du?
Wir reden vor Publikum und wollen dieses Publikum überzeugen, es motivieren oder ihm etwas verkaufen. Die Voraussetzung für jegliche Interaktion mit dem Publikum ist, dass die Menschen sich von uns angesprochen fühlen. Wann fühlen Menschen sich angesprochen? Wenn sie das Gefühl haben, wir haben eine Vorstellung von ihren Interessen, Belangen, von ihrem Umfeld, vielleicht sogar von ihrem Leben. Wenn das durchschnittliche Alter des Publikums 12 Jahre ist wirst du anders sprechen und auftreten als wenn es 70 ist.
Kontakt zum Publikum
Wir wollen von der ersten Sekunde an den Kontakt zum Publikum herstellen und während des gesamten Vortrags wach und lebendig halten. Das erreichen wir, indem wir möglichst genau wissen, wer uns da eigentlich zuhört. Manchmal lässt sich diese Frage schnell beantworten: Es sind Kinder der 4. Klasse oder die Mitarbeiter*innen der Vertriebsabteilung. Manchmal ist eine Gruppe heterogener. Dann frage beim Veranstalter nach, was das für Leute sind, die dorthin kommen. Sieh dir den Veranstaltungsort an, geh vielleicht selbst einmal zu einem Event dort und analysiere die Besucher*innen.
Je klarer mir ist, vor wem ich auftrete, desto besser kann ich einschätzen, was mein Publikum versteht. Welche Abkürzungen sollte ich erklären? Werden Fremdwörter verstanden, Vergleiche, Metaphern, Humor? Fast immer haben wir einige Anhaltspunkte über unser Publikum. Was verbindet die Menschen, die deinen Vortrag hören? Was könnte sie interessieren? Welche Sprache verstehen sie?
Analysiere dein Publikum, damit du deinen Vortrag sprachlich und inhaltlich anpassen kannst.
3. Thema eingrenzen – Weniger ist mehr 😅
Das ist vielleicht die größte Herausforderung beim Vorbereiten eines Vortrags. Ich erlebe es in allen denkbaren Varianten in meinen Coachings. Es wird zu viel, zu detailliert, zu ausführlich gesprochen. Dadurch wird der Vortrag langatmig, unklar strukturiert, und am Ende wurde viel Zeit auf den Einstieg verwendet, mit den Stationen der Ausbildung, allen Überlegungen, die man sich im Vorfeld des Vortrags gemacht hatte und ein paar Anekdoten, dass plötzlich für das Wesentliche die Zeit fehlt!
Damit das nicht passiert, ist es essentiell, sich zu überlegen: Was ist mein Thema? Welchen Aspekt dieses Themas will ich hervorheben? Was ist mein Ziel mit diesem Thema (siehe auch Schritt 1)?
Konkretes Beispiel: Anfrage für einen 60-minütigen Vortrag
Anfrage zu einem Impulsvortrag von 60 Minuten. Thema: Nervosität. Zu diesem Thema habe ich sehr viel zu sagen, ich bin seit 30 Jahren Schauspielerin, ich habe Kollegen erlebt, die furchtbar unter Lampenfieber litten, ich habe in unterschiedlichsten Situationen mit Nervosität vor Auftritten zu kämpfen gehabt. Abgesehen davon lese ich seit über 15 Jahren Bücher zu dem Thema, gebe Workshops, rede mit Menschen. Kurz: Das Thema ist riesengroß und ich könnte problemlos viele Stunden am Stück darüber sprechen. Nun ist die Aufgabe, 60 Minuten damit zu füllen. Was ist essentiell? Was soll ich weglassen? Was ist mein Ziel?
Fangen wir mit Schritt 1, mit dem Ziel an: Mein Ziel ist Ermutigung. Ich will dem Publikum vermitteln: Nervosität gehört dazu, für die einen mehr, für die anderen weniger. Sie ist kein Grund, Präsentationen oder andere Redegelegenheiten zu meiden. Denn: Man kann lernen, mit Nervosität umzugehen. Es gibt Übungen, die auf körperlicher und mentaler Ebene stärken und uns im Umgang mit Nervosität souveräner werden lassen. Daher ist meine Kernbotschaft: „Der Umgang mit Nervosität lässt sich trainieren“.
Unwichtiges weglassen – Kill your darlings
Jetzt, wo ich Ziel und Kernbotschaft definiert habe, wird deutlich, dass Erlebnisse aus der Schauspielkantine hier ebenso fehl am Platz sind wie die Phasen meiner Ausbildung, an welchen Theatern ich gespielt habe oder welchen Berühmtheiten ich begegnet bin. Ich kann zwar erwähnen, dass auch Profis unter Lampenfieber leiden, aber mehr Zeit für Anekdotisches bleibt nicht, wenn ich mein Ziel verfolge. Das Ziel ist, das Publikum zu ermutigen und ihm in verschiedenen Facetten deutlich zu machen, dass sich der Umgang mit Nervosität trainieren lässt.
Alles, was ich in meinem Vortrag sage, bezieht sich auf das Ziel und die Kernbotschaft. Alles, was sich nicht darauf bezieht, fliegt raus. Das klingt vielleicht ein wenig trocken. Doch es bedeutet nicht, dass du nicht auch witzig sein kannst. Aber im besten Falle: Witzig im Zusammenhang mit deinem Thema.
So, jetzt bist du dran. Was ist dein Ziel? Hast du eine Kernbotschaft? Wieviel Zeit hast du zur Verfügung? Überlege, wie du alles, was deinem Ziel dient und zu deiner Kernbotschaft führt, in der gegebenen Zeit unterbringen kannst.
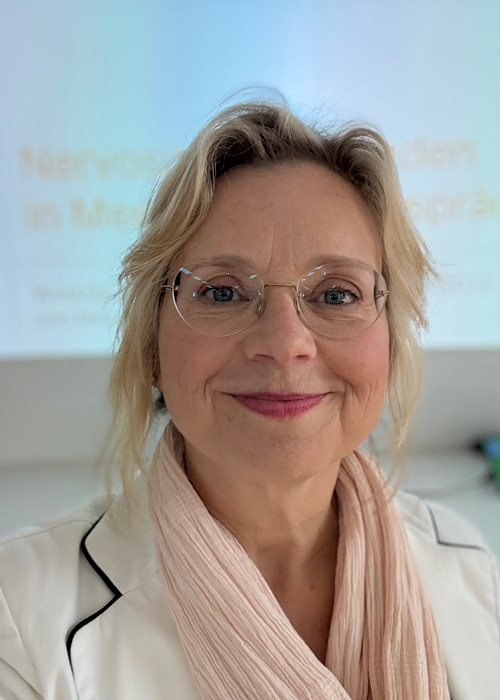
4. Struktur entwickeln – Roter Faden von Anfang bis Ende
Grundsätzlich gilt, dass ein Vortrag aus drei Teilen besteht: Einleitung, Hauptteil und Schluss. Diese Teile können in etwa so strukturiert sein:
- Einleitung
- Begrüßung
- Vorstellung des Themas
- Warum sprichst du über das Thema?
- Evtl. Überblick über den Ablauf
- Hauptteil
- Gliedere deine Inhalte in mindestens zwei, höchsten 5 Abschnitte
- Jeder Abschnitt sollte erkennbar sein, z. B. durch einen klaren Abschluss des vorherigen Abschnitts, eine kurze Pause, eine neue Folie, etc.
- Finde eine verständliche Sprache für deine Inhalte, konkrete Beispiele, passende Bilder, Vergleiche, Metaphern
- Schluss
- Fasse die wichtigste(n) Aussage(n) zusammen
- Fazit oder persönliche Einschätzung
- Ausblick/ Call to action/ Denkanstoß
- Dank/ Fragen beantworten
Am besten passt du die Struktur an deine Bedürfnisse und die Umstände deines Vortrags an. Du kannst auch mit einer Geschichte oder einem Scherz beginnen und erst dann begrüßen oder gleich zu Beginn deinen Call to action benennen. Eine Struktur ist kein Muss, aber sie ist eine große Hilfe in der Vorbereitung. Vor allem aber fällt es den zuhörenden Menschen leichter, die Inhalte eines Vortrags zu erfassen, wenn sie klar strukturiert sind.
5. Gesprochene Sprache
Es gibt diese Vorstellung, ein Vortrag müsse schriftlich erarbeitet werden. Diese Vorstellung hält sich hartnäckig, obwohl sie die Ursache davon ist, dass viele Vorträge sich genauso anhören: nach Schriftsprache. Das führt dazu, dass die Sätze lang und komplex sind, mit vielen Relativ- und anderen Nebensätzen, mit „und“s und „obwohl“s, mit „weiterhin“s und „außerdem“s. Ich übe meine Vorträge mündlich. Das heißt, ich entwickle nach Zielsetzung und Kernbotschaft eine grobe Struktur und spreche diese dann für mich durch (ein gutes Hilfsmittel dafür ist die Diktierfunktion des Smartphones). Wieder und wieder. Dadurch übe ich mich in mündlicher Sprache. Der Vortrag klingt lebendiger, konkreter und verständlicher. Die Sätze werden kürzer. Der Vortrag wird zu einem Text, der hörend verstanden wird. Hörend bedeutet, dass man ad hoc alles verstehen sollte, denn schließlich kann man bei einem Vortrag nicht zurück blättern oder einen Satz zweimal lesen, um ihn zu verstehen. Man ist als Zuhörer*in darauf angewiesen, dass man der Rede folgen kann. Und das geht bei gesprochener Sprache deutlich besser als bei „vorgelesener“ Sprache.
Und für die „Schnellsprecher*innen“ unter der Leserschaft habe ich hier noch einen Blogartikel:„5 Gründe, warum langsam sprechen besser ist als schnell sprechen“.
6. Visualisierung planen – Folien, Bilder & Medien gezielt nutzen
Visualisierungen spielen in vielen Vorträgen eine zu große Rolle. Sie werden oft so gestaltet, dass die Folien im Zentrum des Vortrags stehen. Meiner Meinung nach sollte bei einem Vortrag die vortragende Person der Fixstern der Veranstaltung sein. Menschen interessieren sich für Menschen. Sie wollen von ihnen lernen, ihnen zuhören, ihre Stimme hören. Die wenigsten wollen 20 Stichpunkte auf einer Folie lesen oder komplexe Mind-Maps durchdringen. Es ist weit verbreitet, einen Vortrag anhand von Folien aufzubauen. Ich empfehle dir die gegenteilige Vorgehensweise: Entwickle deinen Vortrag. Wenn du eine klare Struktur hast, überlege dir, wie du wichtige Elemente deines Vortrags visualisieren kannst. Nutze auf den Folien wenig Text, am besten eigenen sich Stichpunkte oder Schlüsselwörter. Wenn du ganze Sätze auf deinen Folien stehen hast, musst du damit rechnen, dass dein Publikum, anstatt dir zuzuhören, liest. Und da jede*r das im eigenen Tempo tut, ist die Aufmerksamkeit des Publikums dann nicht bei dir. Grafiken, Bilder, Fotos hingegen können deinen Vortrag mit einer zusätzlichen Ebene bereichern und lenken das Publikum nicht ab.
7. Üben, üben, üben – aber richtig
Als Schauspielerin werde ich immer wieder gefragt: „Wie kann man sich bloß so viel Text merken?“ Ich habe zum Thema Text lernen einen ganzen Blogartikel verfasst, hier kommst du direkt zum Artikel „In 9 Schritten Text auswendig lernen“. Nun ist es bei einem längeren Vortrag nicht nötig, den Text komplett auswendig zu können. Dennoch ist es sinnvoll, einige Passagen frei sprechen zu können. Denn wenn wir frei sprechen, können wir direkten Blickkontakt zum Publikum aufnehmen. Wir können unsere Aufmerksamkeit im hier und jetzt halten. Und „aufmerksam im hier und jetzt“ ist eine Umschreibung für „präsent sein“. Wenn wir präsent sind, ist es auch unser Publikum. Präsenz ist eine große Qualität auf der Bühne und wir sollten uns immer bemühen, präsente Momente zu ermöglichen. Außerdem ermöglicht uns das freie Sprechen, uns im Raum zu bewegen. Wir können uns ein, zwei Schritte vom Rednerpult wegbewegen, vielleicht sogar auf das Publikum zu gehen und sind nicht an unser Manuskript/den Laptop gefesselt.
Frei sprechen
Freies Sprechen übt man durch freies Sprechen. Und wie beim Üben eines Instruments ist es hilfreich, wenn wir unserem Gehirn vermitteln, worum es geht. Es geht um das Suchen und Finden von Zusammenhängen. Wenn wir uns beim Üben immer wieder unterbrechen und korrigieren, dann lernt das Gehirn genau das: Sprechen, unterbrechen, korrigieren. Das wollen wir im Ernstfall natürlich nicht, wir wollen uns ja nicht im Vortrag unterbrechen und korrigieren. Daher: Übe flüssiges Sprechen. Das bedeutet, wenn du den Satz anders angefangen hast, als ursprünglich geplant, dann unterbrich nicht und setze neu an, sondern bring diesen angefangenen Satz zu einem sinnvollen Ende. In der Aufregung, vor Publikum, passiert es häufig, dass wir Sätze anders beginnen als geplant. Wenn wir genau das üben, sind wir dann nicht schockiert von dem „falschen“ Satzanfang, sondern haben bereits eine Routine entwickelt, jeden möglichen Satzanfang gelassen zu Ende zu bringen.
Improvisieren üben
Richtig üben bedeutet daher, den Vortrag so zu üben, als säße bereits ein Publikum mit im Raum. Wenn du etwas Übung damit hast, wirst du feststellen, dass du dir selbst dabei zuhören kannst, als wärst du Teil des Publikums. Lege dir Stift und Zettel parat, so dass du dir während des Übens Notizen machen kannst. Unterbrich die Rede nicht, sondern schreib dir ein Stichwort auf und bearbeite deinen Vortrag anschließend in Ruhe.
Wenn du so übst, übst du, mit Überraschungen und unerwarteten Formulierungen umzugehen und lässt dich davon nicht aus der Ruhe bringen. Denn Überraschungen und unerwartete Formulierungen sind ein selbstverständlicher Teil eines Live-Auftritts. Wir können sie nicht vermeiden. Aber wir können den souveränen Umgang damit üben.
8. Souverän auftreten – Lampenfieber meistern
Ein Teil deiner Aufmerksamkeit beim Üben deines Vortrags sollte dem körperlichen Aspekt gelten. Wir alle haben Erfahrung mit Lampenfieber und Aufregung. Plötzlich spüren wir das Herz klopfen, die Stimme zittert, die Hände sind unruhig. Das ist völlig normal, wenn wir etwas ungewohntes tun und das auch noch vor Publikum! Der allererste Schritt ist daher, die eigene Nervosität zu akzeptieren. Ich tue etwas Neues, ich wage mich in einen neuen Bereich, ich erweitere meine Komfortzone (und bisher fühlt sie sich noch nicht komfortabel an!). Natürlich bin ich dann aufgeregt.
Der Einstieg setzt Ton, Tempo und Rhythmus
Der nächste Schritt sollte ein Teil deiner Übe-Routine werden. Häufig ist der Anfang eines Vortrags zappelig, unklar, verwurschtelt. Und interessanterweise wird oft genau das geübt. Im Coaching passiert es ganz regelmäßig, dass Leute ihren Vortrag halbherzig starten. Wäre ich nicht dabei, dann bin ich sicher, dass sie immer wieder so üben würden. Und ihr Gehirn dächte dann: Ah, so soll das also sein, wir fangen ganz verwurschtelt an und dann finden wir langsam in den Vortrag rein. Nein, liebes Gehirn, so soll es nicht sein, aber um das zu lernen, müssen wir es üben. Nimm also beim Üben insbesondere den Einstieg ernst. Rede nicht schon beim Auftreten, sondern erst, wenn du auf der Bühne (oder in deinem Zimmer) den Platz eingenommen hast, von dem aus du sprechen möchtest. Dadurch zeigst du deinem Körper, dass keine Gefahr droht, dass er sich einrichten darf, dass du dich nicht beeilen musst. Der Einstieg setzt den Ton für den restlichen Vortrag und wenn du bei den ersten Sätzen das Gefühl hast, du musst dich beeilen, dann ist es sehr schwer, von diesem Gefühl, das dich zum Schnellsprechen animiert, wieder runter zu kommen. Nimm dir daher bewusst Zeit, vor allem beim Üben. So lernen Gehirn und Körper, die Situation auch dann zu meistern, wenn wirklich ein Publikum vor dir sitzt.
Atmen
Als dritten Schritt empfehle ich dir, vor deinem ersten Satz auszuatmen. In der Aufregung halten wir nämlich oft die Luft an (das erlebe ich in meinen Coachings ständig). Wenn wir ausatmen, aktivieren wir die Atmung wieder und zeigen auch dadurch dem Körper, dass keine (wirkliche) Gefahr droht. Probier es mal aus und beobachte die Wirkung, die es auf dich hat.
In meinem Blogartikel „Last-minute Selbstbewusstsein“ findest du 3 weitere erprobte Strategien zum Umgang mit Nervosität, die du auch in letzter Minute noch anwenden kannst.
Falls dir die Existenz deiner Hände beim Vortragen besonders bewusst wird, habe ich auch dazu einen Blogartikel im Angebot: „Wohin mit den Händen beim Präsentieren?“
9. Ein überzeugender Abschluss
Zu guter Letzt: Übe auch deinen Abschluss. Häufig sind Redner*innen so erleichtert, dass nun endlich alles vorbei ist, dass sie nach einem hingenuschelten „Danke“ von der Bühne stürzen. Das ist sehr schade, und wer bis dahin einen souveränen Eindruck vermittelt hat, macht diesen Eindruck damit zunichte. Wenn du also deinen Vortrag übst, dann übe auch, klar und deutlich deinen letzten Satz zu sprechen. Das kann natürlich das allseits beliebte „Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit“ sein, aber es kann auch eine Aufforderung zur Interaktion sein, á la „Ich bin im Anschluss im Foyer und freue mich, wenn wir uns noch ein wenig austauschen. Sprechen Sie mich gerne an!“. Und dann, wenn alles vorbei ist, gehe ganz gelassen und ruhig von der Bühne.
Ausblick: Die nächsten Schritte zum überzeugenden Vortrag
Du brauchst ein Publikum! Wenn du in deinem beruflichen oder privaten Umfeld Vortrags-Themen ans Herz gelegt bekommst, dann gehe die 9 Schritte, heimse das Lob ein und erzähl mir gerne von deinen Erfahrungen!
Wenn du noch auf der Suche bist, wo und worüber du reden könntest, dann schreibe zunächst eine Liste mit 10 möglichen Vortragsthemen. Womit kennst du dich gut aus? Was interessiert dich? Was wirst du häufig gefragt? Im besten Fall sind das Themen, mit denen du im beruflichen oder privaten Umfeld bereits Erfahrung hast. Es muss kein fachliches oder eindeutig berufliches Thema sein, über das du sprichst. Ich arbeite z. B. gerade an einem Vortrag über den Umgang mit Demenz im familiären Kontext, da ich damit Erfahrung habe und diese weitergeben möchte. Auch über einen Teil meiner Familiengeschichte habe ich bereits Vorträge gehalten. Halte die Augen offen – und du wirst dich vor Ideen nicht mehr retten können!
Im nächsten Schritt suche Gelegenheiten. Wo kannst du Vortrags-Erfahrung sammeln? Das kann ein Reel auf Social Media sein, ein Themenblock auf einem Barcamp, ein Webinar oder eine Veranstaltung in einem Nachbarschafts-Treff. Frag deinen Arbeitgeber, ob Interesse an deinem Vortragsthema besteht, die Kirchengemeinde, das Kulturhaus oder Unternehmen, für die dein Thema bereichernd wäre. Sei mutig! Im schlimmsten Fall lehnt jemand ab. Auch daraus kannst du lernen: Warum haben sie nicht angebissen? Hab ich den Benefit klar herausgestellt? Und dann…mach es einfach nochmal!
Du willst „Authentisch Präsentieren“?
In meinem Einzelcoaching „Authentisch Präsentieren!“ bereiten wir gemeinsam deinen überzeugenden Vortrag vor. Wir finden die passende Struktur und sorgen dafür, dass dein Auftritt auf allen Ebenen authentisch und überzeugend wird. Denn die gute Nachricht ist: Alle Aspekte eines Vortrags lassen sich üben und trainieren! Selbstbewusstsein, Körpersprache, Stimme, Charisma und Präsenz – nichts davon muss „angeboren“ sein. Wir können durch Übungen, Mindset-Arbeit und Austausch die Wirkung unserer Vorträge enorm steigern.
Du willst mehr über „Authentisch Präsentieren!“ erfahren? Dann klicke hier, schreibe „Kostenloses Kennenlerngespräch“ und wir besprechen dein Anliegen persönlich.
In meinem Newsletter schreibe ich regelmäßig über Präsentationserfahrungen – sowohl meine eigenen als auch die meiner Coachees. Abonniere den Newsletter, dann verpasst du meine Tipps und Gedanken rund um Vorträge und Auftritte nicht!